08/08/2024 0 Kommentare
Eine Weihnachtsgeschichte für Erwachsene
Eine Weihnachtsgeschichte für Erwachsene
# Neuigkeiten

Eine Weihnachtsgeschichte für Erwachsene
Manchmal ist es weit bis Weihnachten
von Flurin Dewald
Lea war weg. Mit brechender Stimme und Tränen in den Augen verlies sie damals das Haus. Es war kein richtiger Streit, aber sie hatte eine Wut im Bauch, eine unbestimmbare Wut auf Mama und Papa, auf das Haus, auf diese Stadt, dieses Land, dieses Leben! Eine richtige Verabschiedung gab es nicht, die Tür knallte, und Lea war verschwunden.
Es war Weihnachten. Martin und seine Frau Sarah dachten an diesem Tag nur noch an ihre Tochter. Über sie zu sprechen war zu schmerzhaft für sie beide, so sehr vermissten sie Lea. Darüber, wo sie war, konnte man nur rätseln. In einem der beiden Ferienhäuser, im Engadin und in Spanien war sie nicht, das hatte er abklären lassen. Vielleicht Berlin, vielleicht London? Vielleicht aber auch Tibet?
Jetzt war sie am Telefon. Die Berge im künstlichen Hintergrund bei Skype wollten so gar nicht passen, hätte Lea doch die Berge zuletzt am liebsten gesprengt in ihrem Zorn. Martin blickte kurz durch die Glasfront auf die echten Berge, dann sofort wieder auf das Display des iPads. Hier war sie, seine Tochter, aber sie sah nicht gut aus, verpixelt, wackelig und in ruckelnden Bildern. Immer wieder brach die Verbindung ab. Aber auch dünn und blass wirkte sie. Hatte Lea das Virus? Hatte sie sich verausgabt? Drogen genommen? Wo mochte sie sein, was mochte sie brauchen?
«Ich habe kein Geld mehr.» Martin und Sarah waren sprachlos. Wie konnte sie so schnell über 30000 Franken ausgeben? Jetzt brach es aus Lea heraus: «Ich habe gar nichts mehr. Kann ich…» Wieder blieb das Bild stehen, die Verbindung brach ab.
Martins Gedanken überschlugen sich und es kamen ihm die Tränen. War wirklich Geld das Problem? Er hatte sein Leben lang gearbeitet – sehr viel gearbeitet und gut verdient. Die Armut seiner Eltern saß ihm noch in den Knochen. Der eigenen Familie sollte es niemals an Geld mangeln. Lea mangelte es offensichtlich an etwas anderem. Warum verlies sie Wohlstand und Sicherheit, Familie und Freunde, verprasste das Ersparte in wenigen Wochen?
Die Verbindung war erneut hergestellt, Lea wieder da. Etwas gefasster als vorhin fragte Lea unvermittelt: «Papa, glaubst du an das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Glaubst du, dass es möglich ist?» Das hatte er nicht erwartet, obwohl er vorhin selbst daran denken musste. Als Lea klein und noch vieles gut war, lag sie manchmal auf Martins Bauch und er las ihr die Abenteuergeschichten vor von Sindbad dem Seefahrer oder Pippi Langstrumpf. Und er las die Geschichten aus der Bibel. Mehr noch als Tausend und eine Nacht oder Astrid Lindgren liebte Lea die Gleichnisse im Neuen Testament, die Geschichten vom Schatz im Acker, vom Sämann, vom verlorenen Sohn. Und dann deuteten sie gemeinsam um die Wette. Jedes Mal hatten sie wieder eine andere Bedeutung gefunden, was das Sandkorn, was der Schatz, was der Acker darstellen könnte. Diese Geschichten kamen ihnen beiden vor wie Zauberhüte, aus denen man immer mehr herausziehen konnte, obwohl gar nichts da war.
«Papa, Mama!» Lea riss ihn aus den Gedanken. «Ich will ehrlich mit euch sein: Ich musste raus aus der Schweiz, aber vor allem weg von daheim. Die Anspannung, der Druck, der Stress zuhause, ich habe das alles nicht mehr ausgehalten.» Martin wusste, wovon sie sprach. Ihm kamen die zwielichtigen Geschäfte in den Sinn. Sie waren in den letzten Jahren immer profitabler geworden und nahmen ihn zunehmend in Anspruch. Seine ermattete Beziehung zu Sarah kam ihm vor Augen. Ihre Ehe war heute wortkarger und giftiger denn je. Und dann der Glaube: diese leeren Gebete und unerträglichen Gedanken. «Ich war auf Ibiza, wollte feiern und die Enge zuhause vergessen, mein altes Leben, die Sorgen, den Druck loswerden», erzählte Lea jetzt in klarem Bild und Ton. «Zuerst war es großartig, die Wärme, die Leute, das Meer. Dann wurde ich krank, sehr krank. Es war schrecklich. Aber im Spital ist etwas passiert mit mir. Seit langer Zeit habe ich gebetet – ich will nur noch nach Hause.»
Martin fragt sich: «Was bedeutet zu Hause sein wirklich?» Jetzt brach für Martin alles ein. Draußen schneit es dicht. Die erste weiße Weihnacht seit Jahren. Martin fragt sich: «Was bedeutet zu Hause sein wirklich?»
Auf dem Display wird es dunkel, der Gebirgshintergrund verschwindet. Nur der Schein einer Laterne beleuchtet Leas Gesicht, das sich rhythmisch bewegt zu ihren Schritten auf dem Kies. Martin und Sarah sehen einander an, mit plötzlich vertrautem Blick, in dem sich dieselbe Frage, dieselbe Hoffnung spiegelt – bis es an der Haustür klingelt.
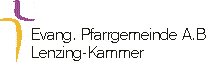

Kommentare